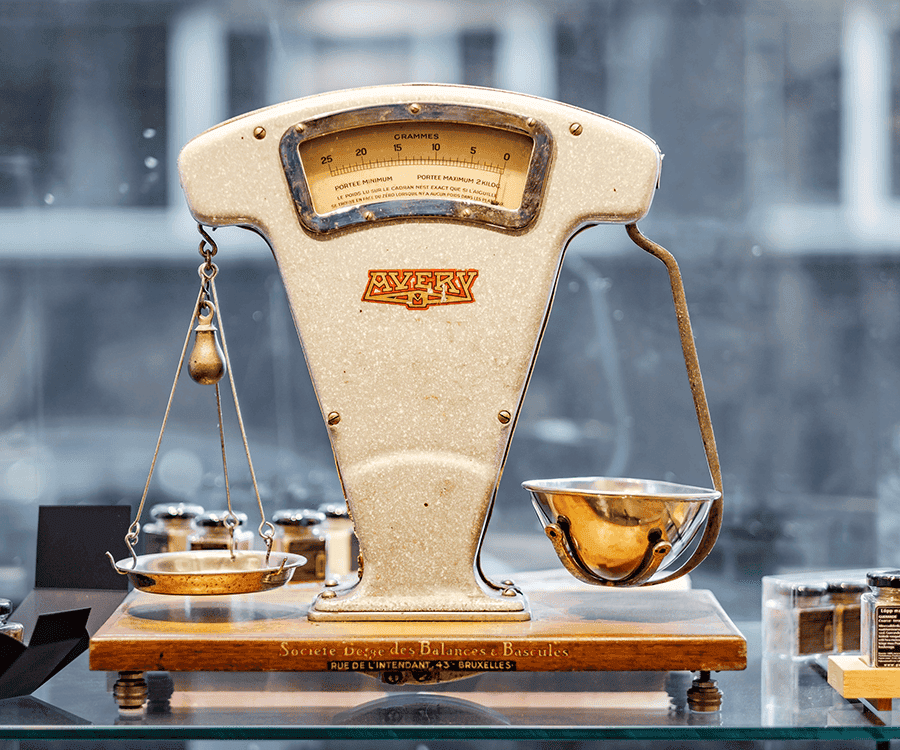Wie entwickeln sich die Geschäfte in Ihrem Unternehmen? Hat sich die Leistung Ihrer Firma in den vergangenen Jahren gesteigert? Und erzielen andere Firmen womöglich bessere Erfolge? Um Fragen wie diese zu beantworten, lohnt sich die Erstellung einer Erfolgsrechnung. Wer in regelmäßigen Abständen Erfolgsrechnungen erstellt, kann sich ein besseres Bild über die eigenen wirtschaftlichen Leistungen machen. Innerhalb des kleinen oder mittleren Unternehmens (KMU) zeigt die Erfolgsrechnung, wie gut die finanzielle Unternehmensführung gelingt. Akteuren außerhalb des Unternehmens dient die Rechnung etwa bei Kreditanträgen.
Zusammenstellung der Erfolgsrechnung
Unabhängig davon, ob pro Monat, Quartal oder Jahr – die Erfolgsrechnung zeigt, ob die Tätigkeiten eines Unternehmens zu mehr Gewinnen oder Verlusten geführt haben. Um das beurteilen zu können, sieht man sich die beiden Hauptbestandteile der Erfolgsrechnung genauer an: Ertrag und Aufwand. Der größte Teil des Ertrages ergibt sich meist aus Erlösen durch die betriebliche Tätigkeit sowie aus Erträgen durch Lieferungen und Leistungen – Insgesamt also die vom Unternehmen erbrachten Leistungen. Doch um diese Leistungen zu erbringen, muss die Firma wiederum Leistungen in Anspruch nehmen. So zum Beispiel die Gehälter der Angestellten und betriebliche Kosten, wie etwa die Miete der Räumlichkeiten.
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Auch an der einstufigen Erfolgsrechnung lässt sich die finanzielle Entwicklung eines Unternehmens ablesen. Jedoch vermittelt sie lediglich die Einnahmen, Ausgaben und den Unternehmensgewinn. Etwas komplexer ist die zweistufige Erfolgsrechnung, die aus einem Betriebsbereich und einem betriebsfremden Bereich besteht. Um einen noch besseren Überblick über die Erfolgsrechnung zu erhalten, wird diese des Weiteren in drei Stufen unterteilt. Diese drei Stufen können in einer Liste oder Tabelle visualisiert werden, in der Aufwände und Erträge verglichen werden.
- Stufe 1 - Die erste Stufe der Erfolgsrechnung liefert das Bruttoergebnis, der mit den direkten Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens zusammenhängt. Für dieses Ergebnis werden Warenertrag, Produktionserlös oder Dienstleistungsertrag dem Material- und Warenaufwand gegenübergestellt. Die erste Stufe stellt die Aufwände und Erträge der Kontenklassen 3 und 4 dar.
- Stufe 2 - Aus der zweiten Stufe geht das Betriebsergebnis hervor, der aussagekräftiger ist, da er sämtliche betrieblichen Aktivitäten beinhaltet. Dazu gehören etwa der Personalaufwand sowie die Aufwendungen für Fahrzeuge, Werbung und Räumlichkeiten, die etwa den Zinserträgen gegenüberstehen. Hier müssen die Posten der Kontenklassen 5 und 6 berücksichtigt werden.
- Stufe 3 - Die dritte Ebene werden die Aufwände und Erträge der Kontenklassen 7 und 8 mit dem Betriebsgewinn verrechnet. Dazu gehören betriebsfremde und außerordentliche Posten als auch betriebliche Nebenerfolge.
Ist die Ertragsseite am Ende der dreistufigen Erfolgsrechnung größer, wurde ein Unternehmensgewinn erzielt. In der Schweiz ist gesetzlich festgelegt, dass jedes Unternehmen im Jahresabschluss eine Erfolgsrechnung mit mehreren Stufen vorlegen muss. Die Verwendung von Kontenrahmen beziehungsweise Kontenplänen unterstützen bei der Erstellung aussagekräftiger Bilanzen und Erfolgsrechnungen.
Rechtliche Grundlage
Unternehmen müssen bei der mehrstufigen Erfolgsrechnung klare Vorgaben einhalten. Nur dann kann der Jahresabschluss von den Wirtschaftsprüfern anerkannt werden. Neben der Erfolgsrechnung gehören die Bilanz sowie der Anhang zur Jahresrechnung. Im Artikel 958 des Obligationenrechts (OR) ist festgeschrieben, dass ein Unternehmen jedes Jahr einen Jahresabschluss vorlegen muss. Genauer heißt es in dem Gesetz, dass eine Firma ihre wirtschaftliche Lage so darstellen muss, dass Dritte ein zuverlässiges Urteil fällen können. Es sollte also kein Interpretationsspielraum in Bezug auf die Gewinne und Ergebnisse entstehen. Laut Artikel 959b des Obligationenrechts gibt es zwei Möglichkeiten für die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung.
- Zum einen die Absatzerfolgsrechnung, die mindestens die acht im Gesetz beschriebenen Positionen enthalten muss.
- Zum anderen die Produktionserfolgsrechnung, in der mindestens die elf gesetzlich definierten Positionen ausgewiesen werden müssen. Diese Form der Erfolgsrechnung wird häufiger verwendet.
Unterschied zwischen Bilanz und Erfolgsrechnung
Der wichtigste Faktor um Bilanz und Erfolgsrechnung zu unterscheiden, ist der zeitliche. Während die Bilanz die Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigt, stellt die Erfolgsrechnung die Werte im Detail über einen bestimmten Zeitraum dar. Was beide gemeinsam haben: Sie sind die Hauptbestandteile des Jahresabschlusses. Die Bilanz wird verwendet, um Auskunft über die aktuelle Finanzlage eines Unternehmens zu erhalten und zeigt an, wie hoch das Vermögen zu einem bestimmten Datum ist. Hierfür werden die Aktiven und Passiven gegenübergestellt, damit das Unternehmen erkennt, woher das Geld stammt und worin es investiert wird. Statt Aktiven und Passiven stellt die Erfolgsrechnung Aufwendungen und Erträge gegenüber. Dadurch kann ermittelt werden, ob über einen bestimmten Zeitraum Gewinne oder Verluste entstanden sind. Bei der Erfolgsrechnung wird also eine Periode, wie etwa ein Quartal oder Jahr, betrachtet, bei der Bilanz ein einzelner Zeitpunkt.